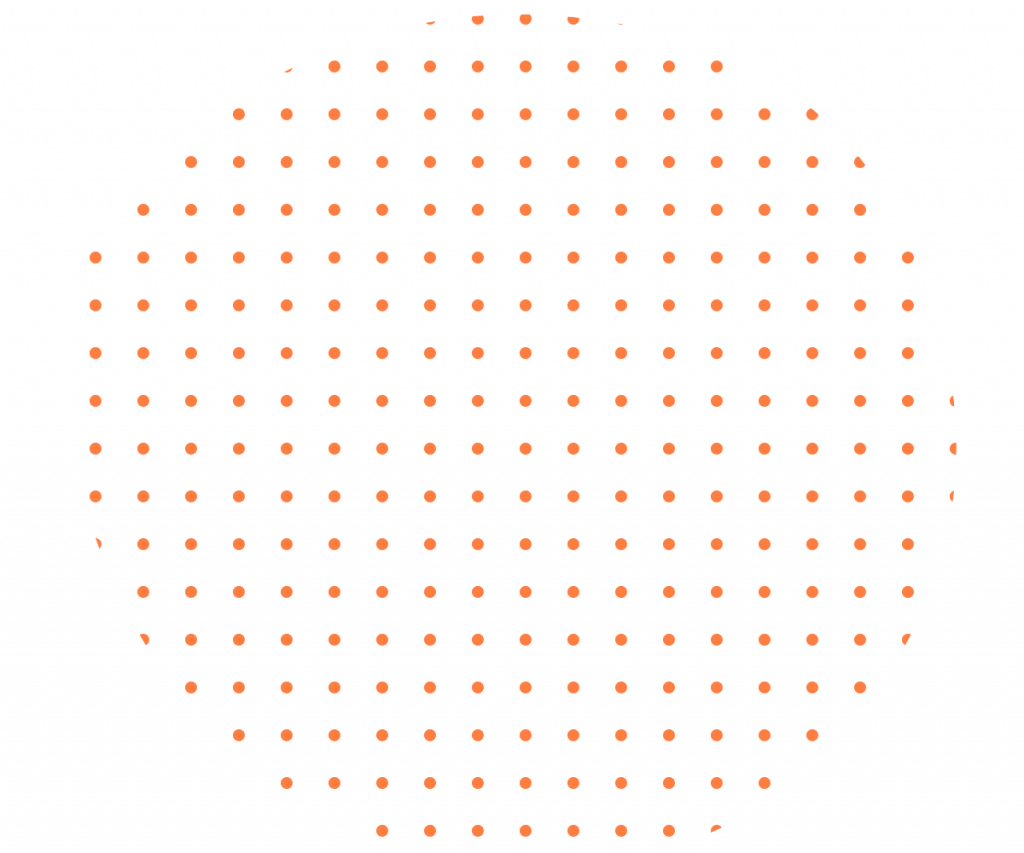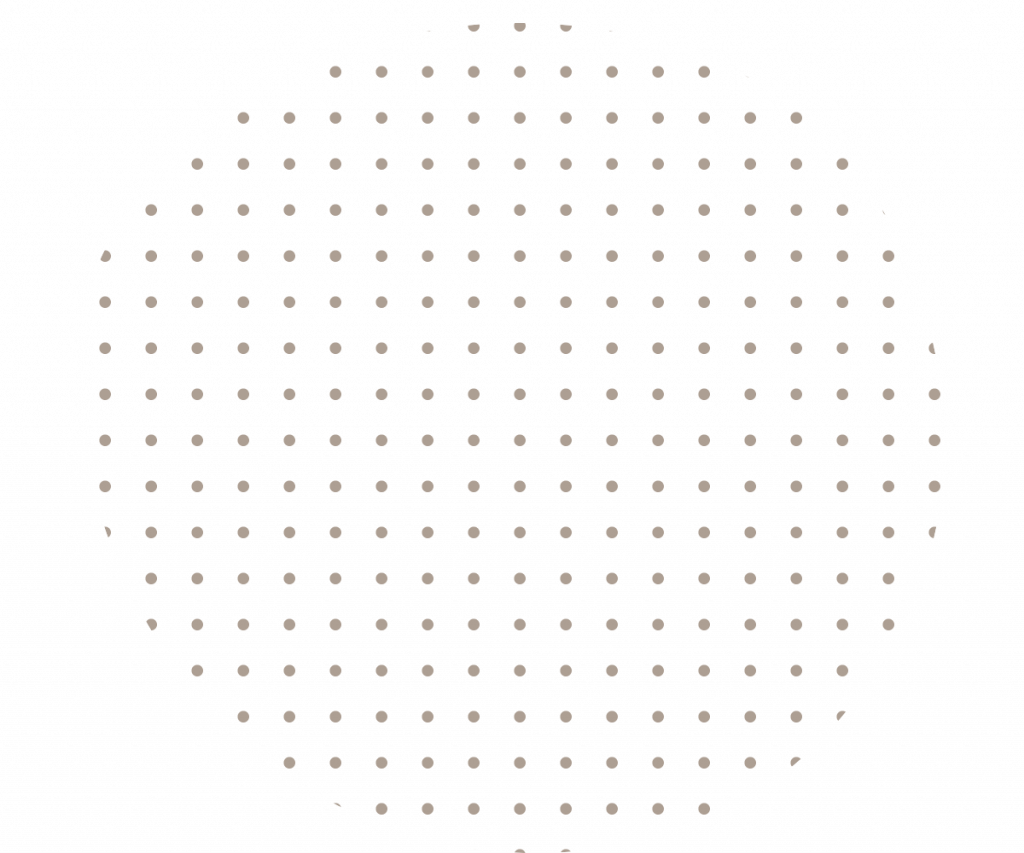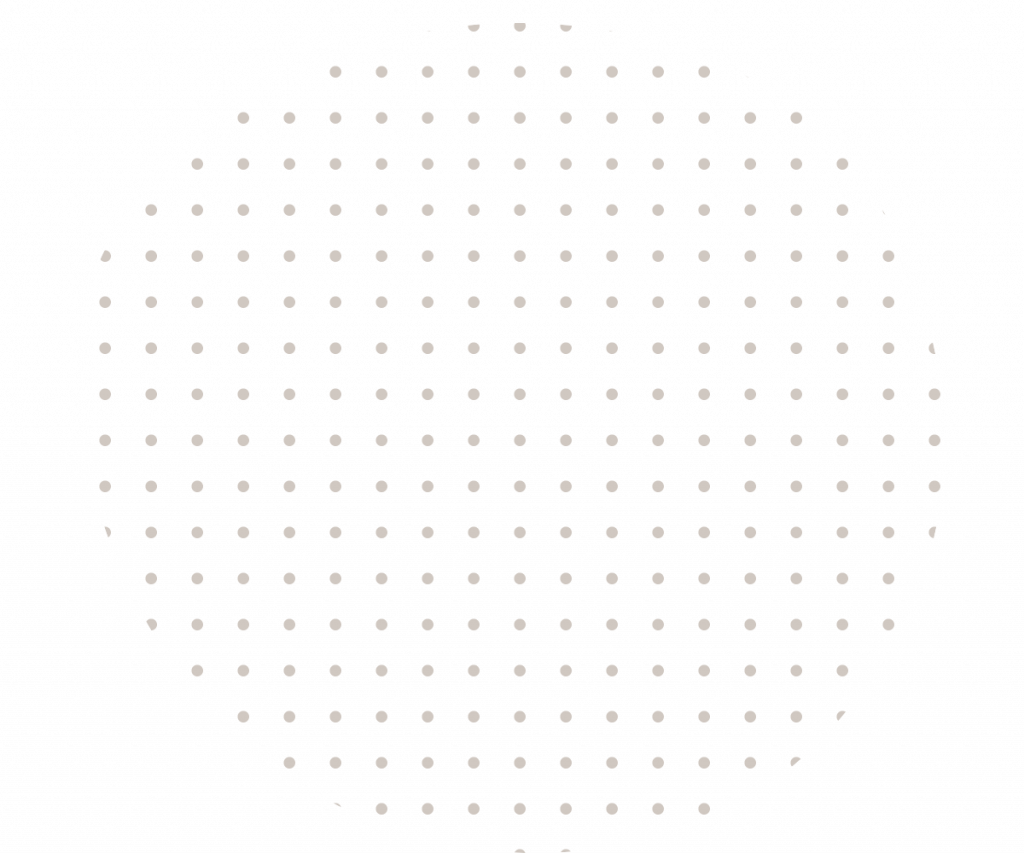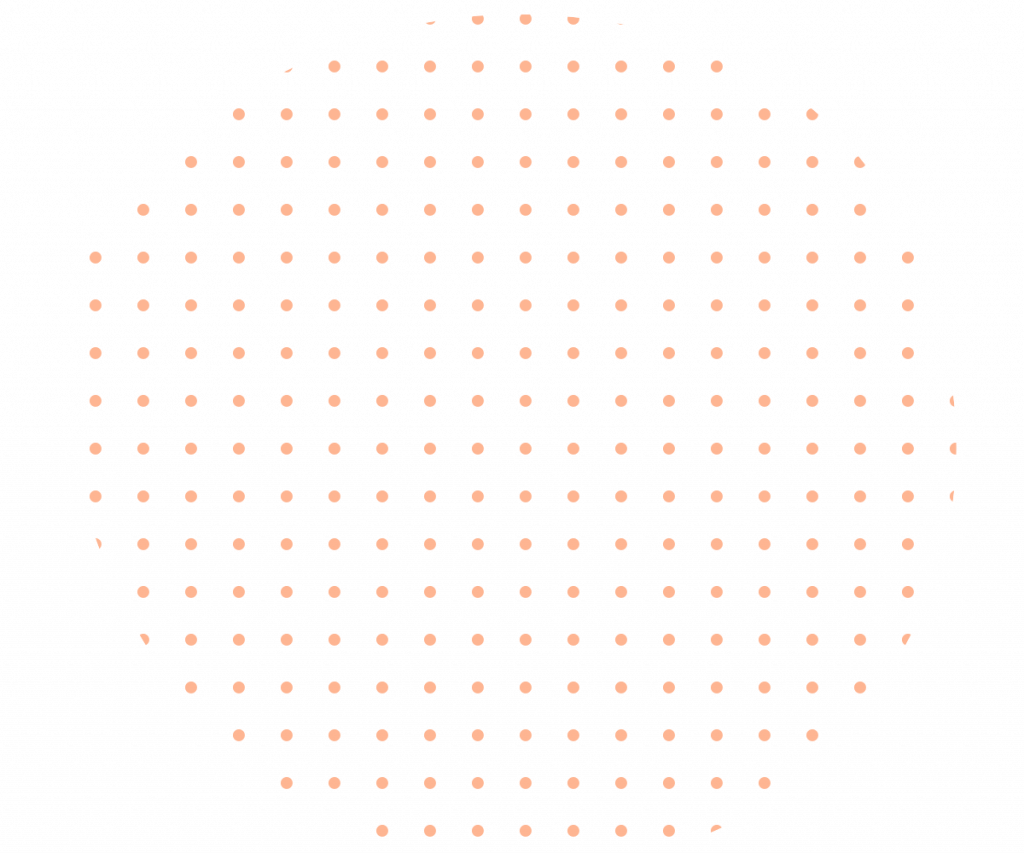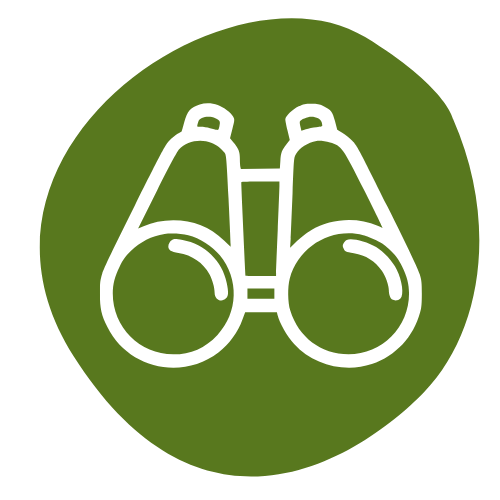Startseite » Ich bin Gast

Führungen & Freizeitangebote

Wandern und Radfahren
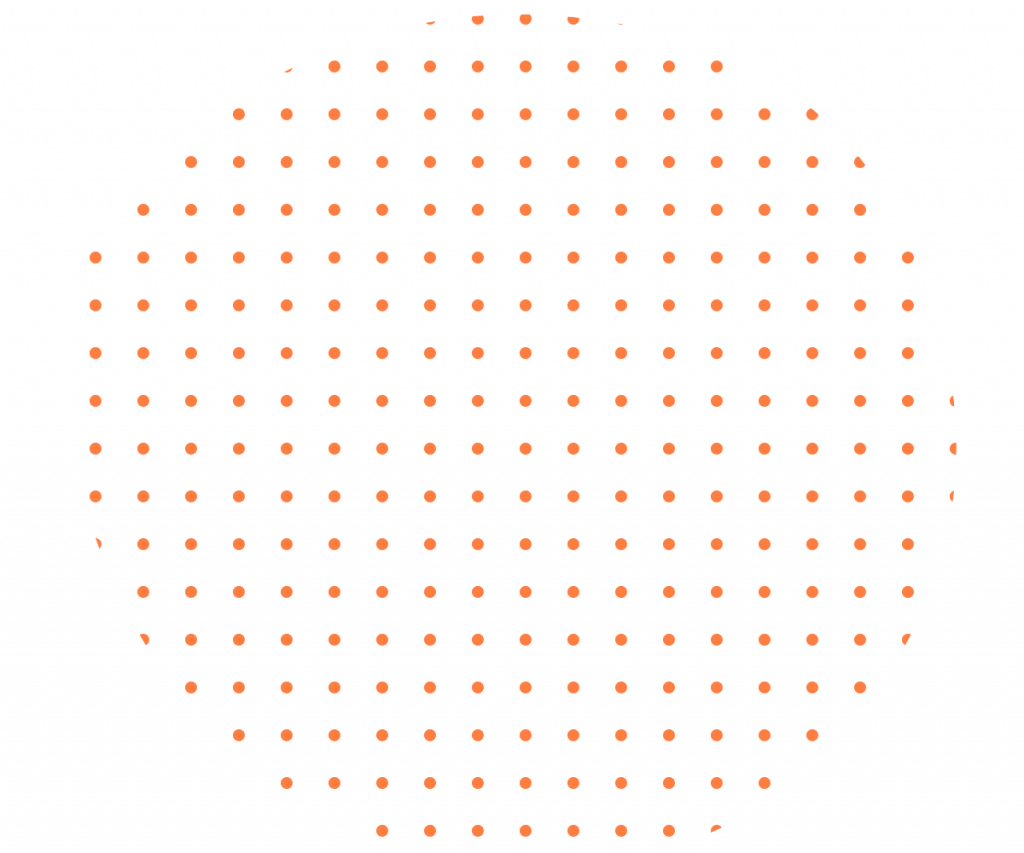
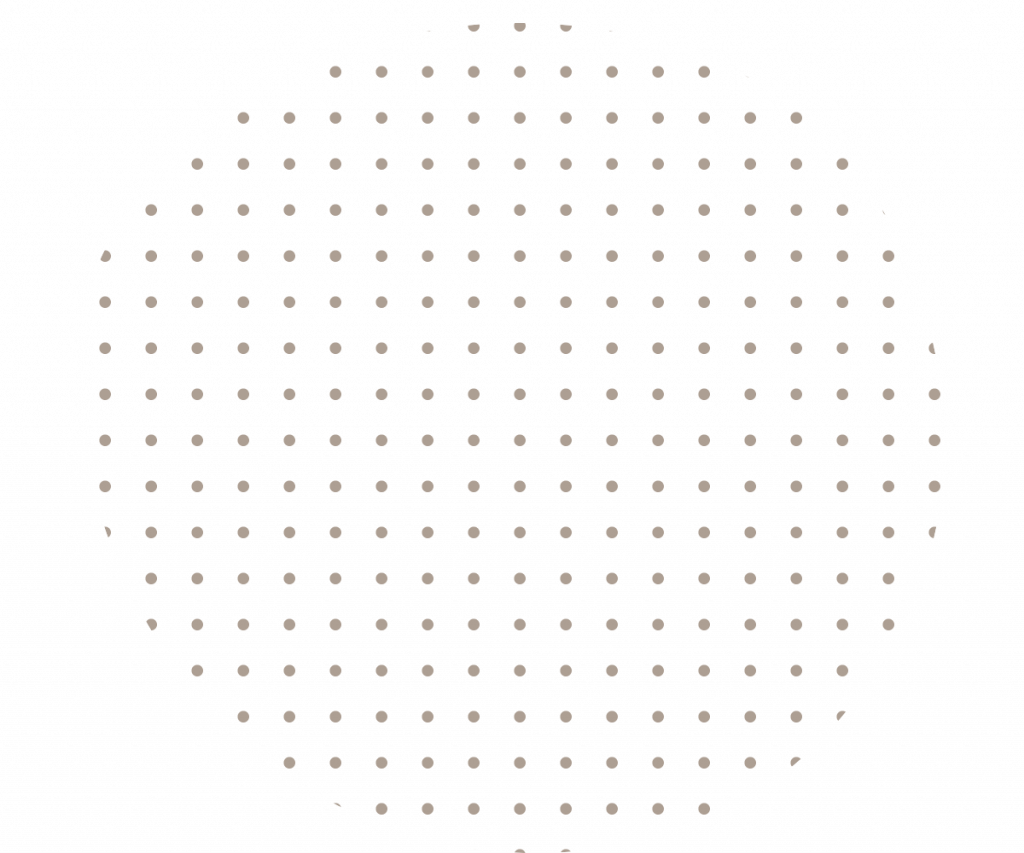
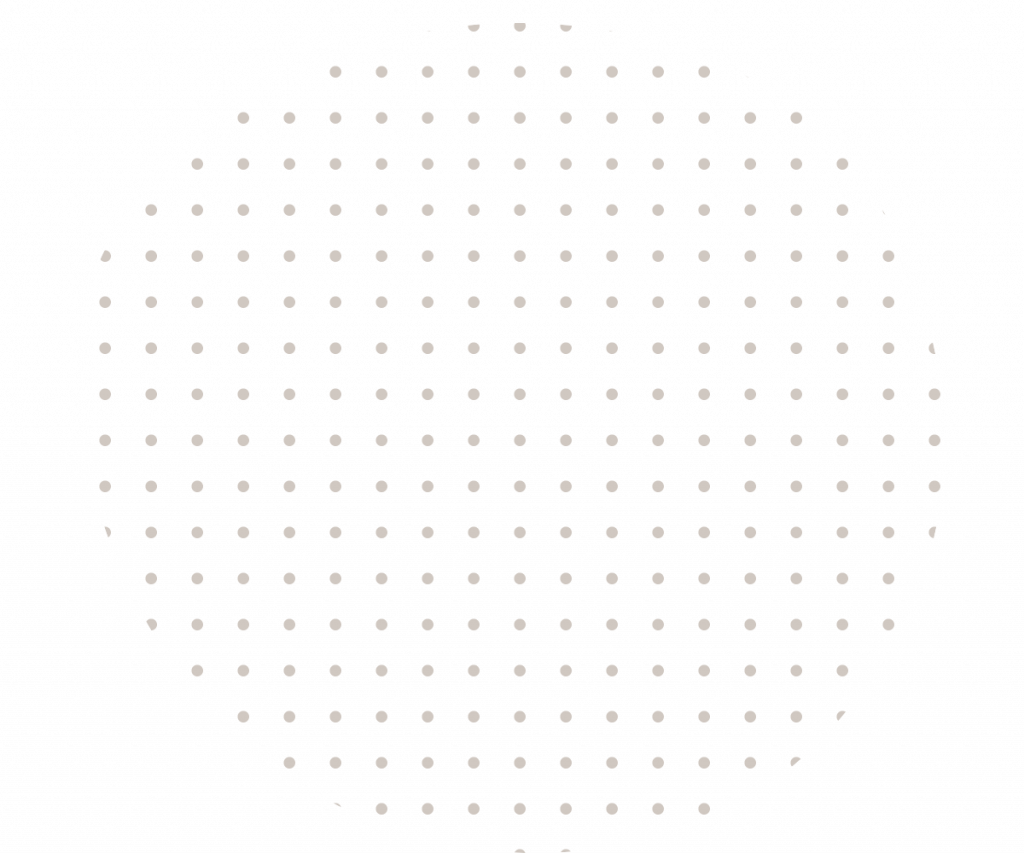
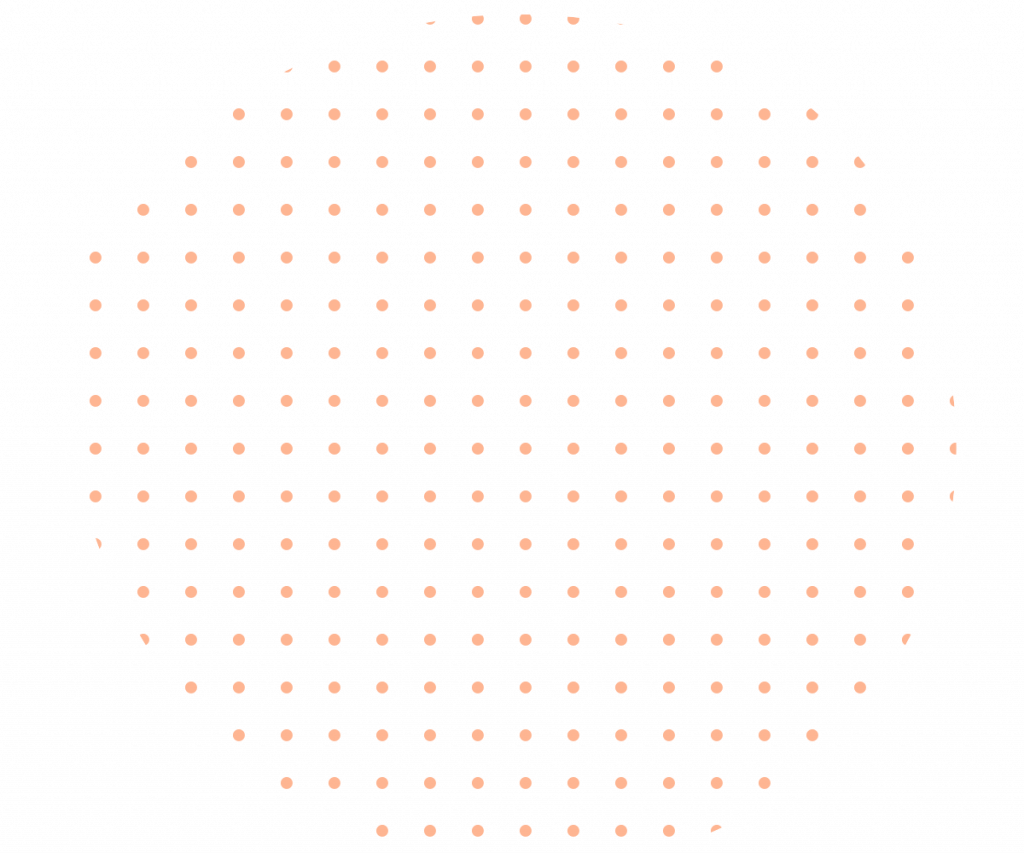

Übernachten

Führungen & Freizeitangebote
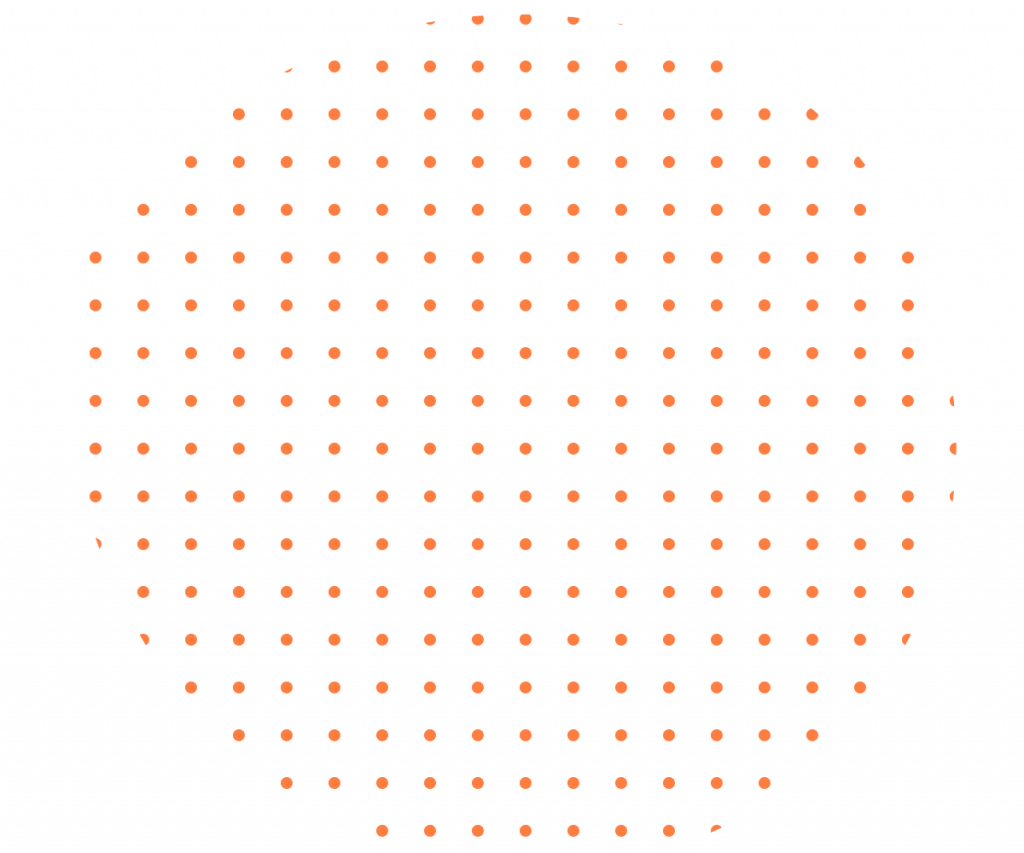
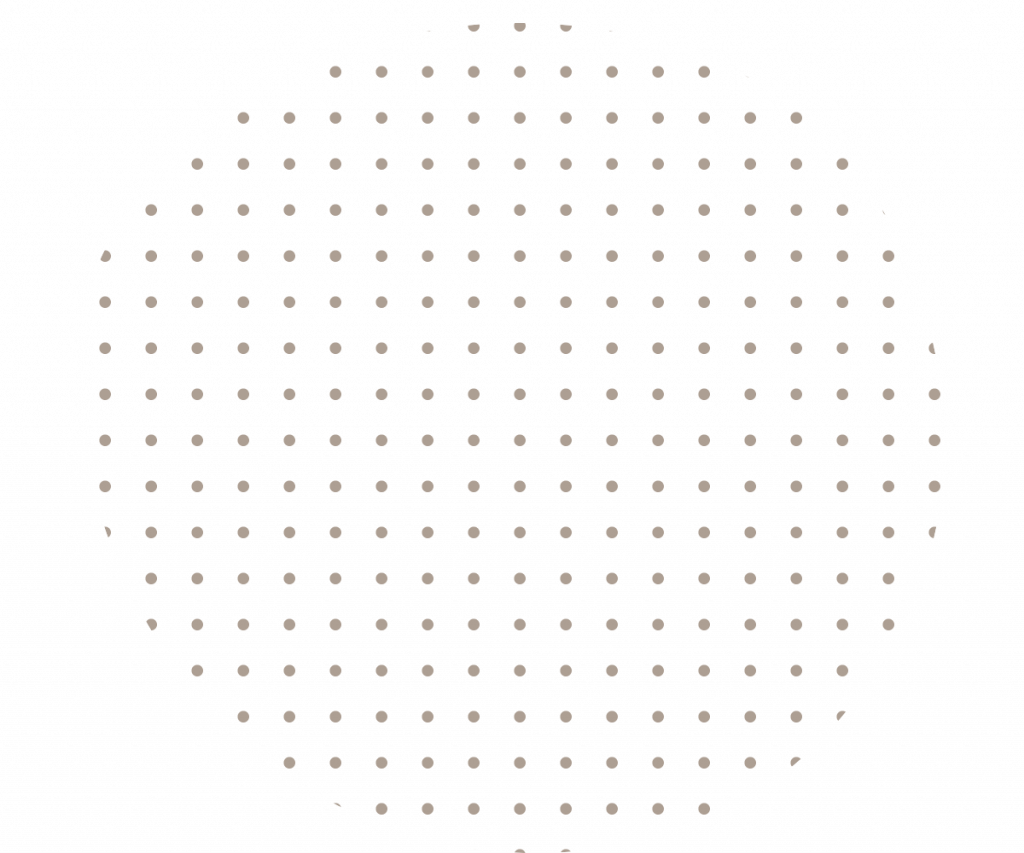
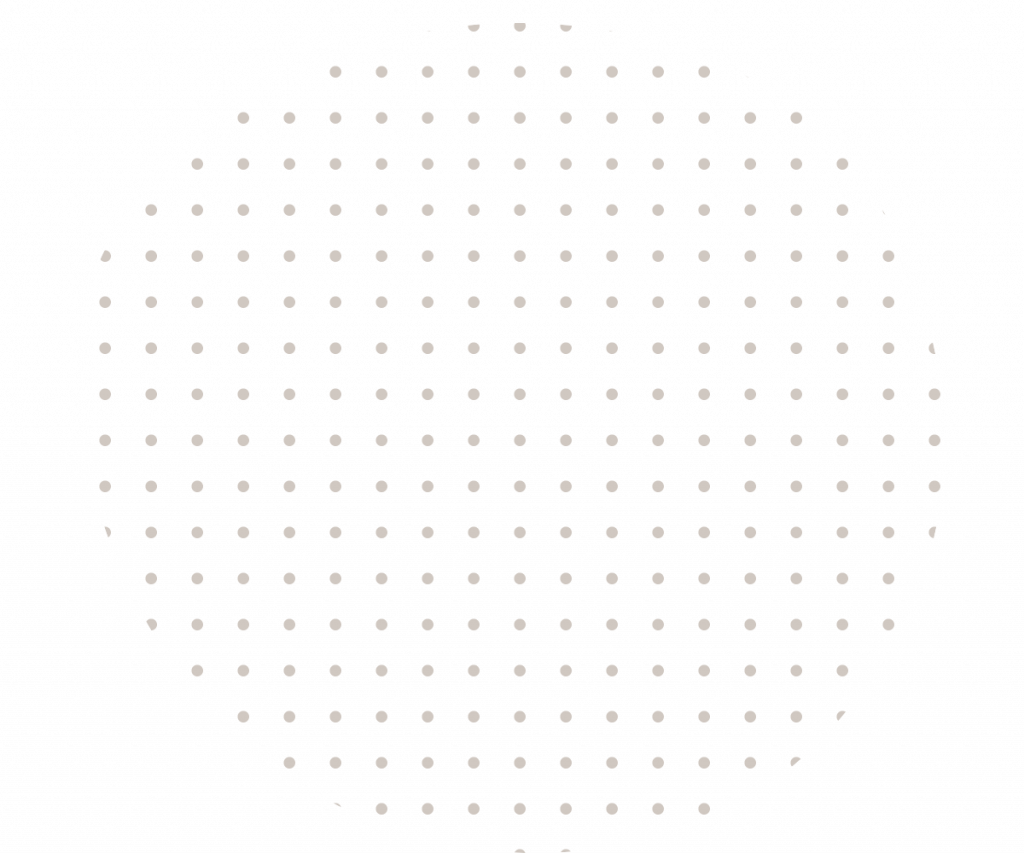
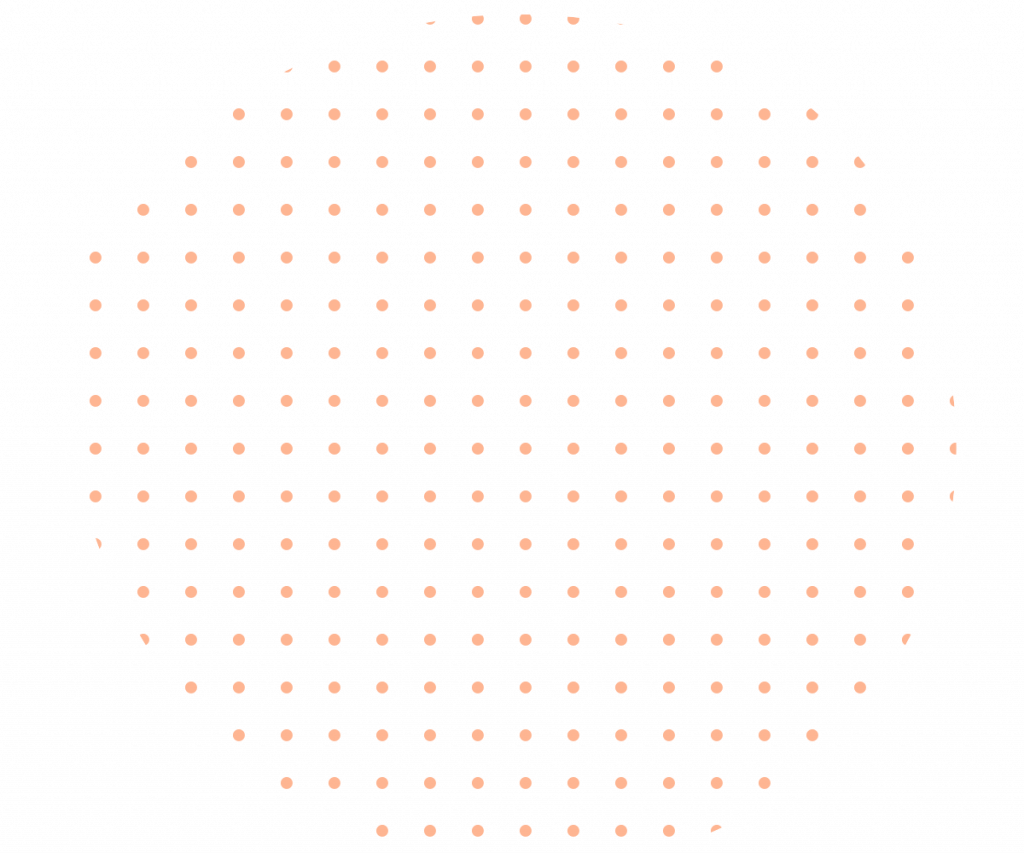

Öffentliche
Verkehrsmittel